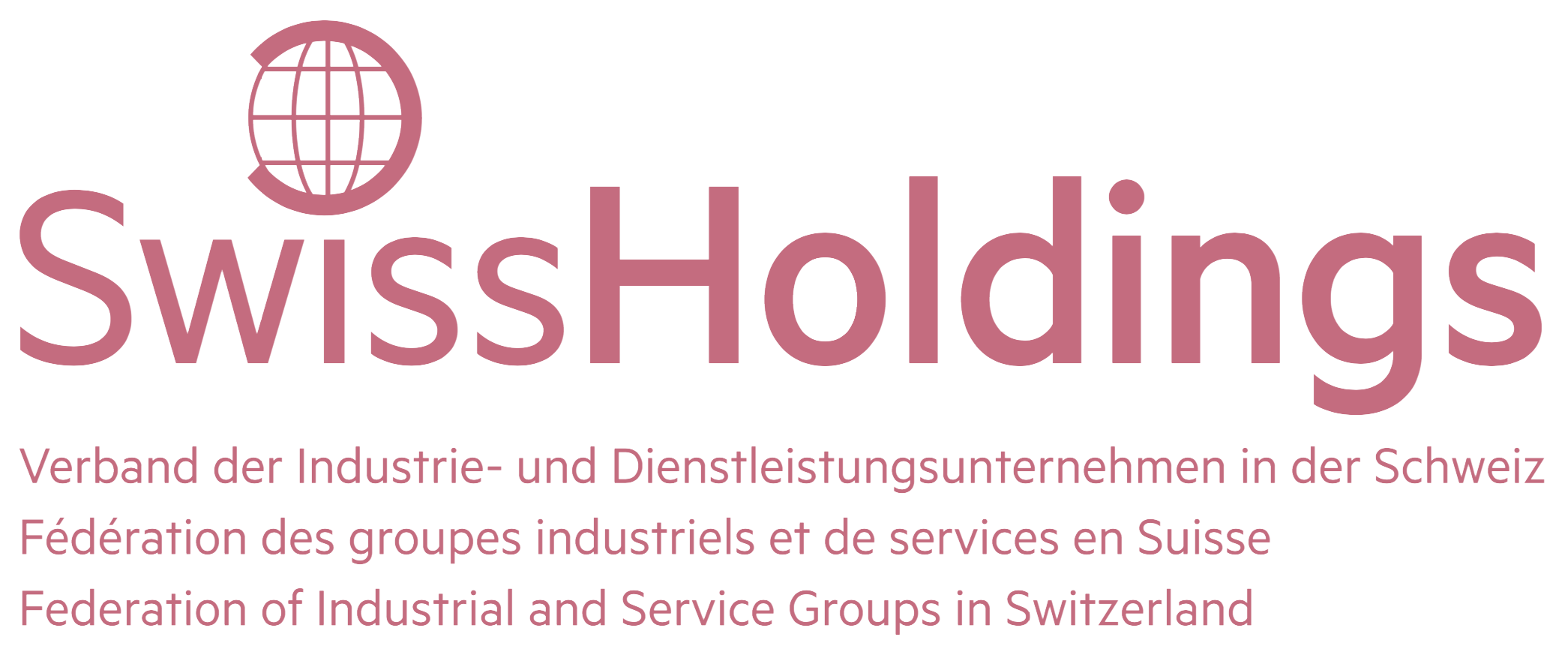Aktuelle Geschäfte und Themen
Mit unserem Update geben wir alle zwei Monate einen ausführlichen Überblick über die für unseren Verband relevanten Geschäfte. Dazu gehören der Inhalt der Geschäfte, der Stand und ein Ausblick des politischen Prozesses sowie unsere Positionen. Auf dieser Seite finden Sie eine kurze Zusammenfassung aller Geschäfte. Das vollständige Update ist über den Button unten abrufbar.

Fachbereich Recht
Die Vorlage für ein Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen verfolgt das Ziel, die Integrität des Finanz- und Wirtschaftsstandorts Schweiz weiter zu stärken. Hierbei sollen Massnahmen eingeführt werden, darunter die Schaffung eines eidgenössischen Registers der wirtschaftlich berechtigten Personen sowie weitere gezielte Schritte, um die Bekämpfung von Geldwäscherei und Wirtschaftskriminalität effektiver zu gestalten. Die vorgeschlagenen Massnahmen sollen zudem den inter-nationalen Standards der Financial Action Task Force und des Global Forum on Transparency and Exchange of Information Tax Purposes entsprechen.
Das Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) hat sich gemäss einem Bericht des EFD bisher mehrheitlich bewährt. Der Bundesrat unterzieht dieses im Rahmen einer periodischen und generellen Überprüfung. Dabei sollen insbesondere Transparenz und Rechtssicherheit in bestimmten Regulierungsbereichen gestärkt werden. Die Vernehmlassung dazu wird Mitte 2024 eröffnet.
Der Bundesrat hat am 24. Mai 2023 die Botschaft zur Teilrevision des Kartellgesetzes (23.047) verabschiedet. Die Teilrevision zielt insbesondere darauf ab, die schweizerischen Zusammenschlusskontrolle zu modernisieren und die internationalen Standards anzupassen. Zusätzlich strebt die Revision an, das Kartellzivilrecht zu stärken und das Widerspruchsverfahren praxistauglicher zu gestalten. In diesem Zusammenhang hat der Bundesrat das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) angewiesen, im ersten Quartal 2024 einen Vorschlag für eine Institutionenreform vorzulegen. Die Wirtschafts- und Abgabekommission des Ständerats (WAK-S) hat ihre Beratungen im ersten Quartal 2024 aufgenommen. SwissHoldings begrüsst ausdrücklich, dass die lange geforderte Institutionenreform nun Teil der Revision ist.
Im Rahmen der Kartellgesetzrevision wird, wie von verschiedenen Seiten während der Vernehmlassung gefordert, die Reform der Wettbewerbsbehörden in einem separaten Verfahren behandelt. Dieser Ansatz soll sicherstellen, dass die Revision des Kartellgesetzes nicht erneut an Hindernissen scheitert. Das WBF, das vom Bundesrat mit dieser Aufgabe betraut wurde, plant im ersten Quartal 2024 einen konkreteren Umsetzungsvorschlag vorzulegen. Derzeit werden verschiedene Option in Zusammenarbeit mit einer eigens dafür eingesetzten Expertenkommission geprüft. Bis Mitte 2025 wird eine Vernehmlassungsvorlage vorliegen.
Fachbereich Steuern
Das von der G20 initiierte Projekt zur Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft steht vor einer unsicheren Zukunft. Selbst bei den G20-Mitgliedstaaten ist die anfängliche Euphorie verflogen. Bei der Säule 1 zeichnet sich ab, dass die neuen Regeln gar nicht in Kraft gesetzt werden, da die USA das nötige multilaterale Abkommen kaum ratifizieren werden. Ohne die USA kann die angestrebte Umverteilung von Steuersubstrat von Sitzstaaten wie der Schweiz zu Marktstaaten wie China oder Indien nicht einmal gestartet werden. Nur leicht besser sieht es bei der zweiten Projektsäule, der sog. OECD-Mindestbesteuerung, aus. Anfang 2024 haben fast alle europäischen Staaten mit der Umsetzung der Mindestbesteuerung begonnen. Viele der volkswirtschaftlich wichtigen Staaten wie die USA, China oder Indien zeigen aktuell immer noch keine Anstalten, die Mindestbesteuerung einführen zu wollen. Sollte bei den US-Wahlen Donald Trump zum Präsidenten gewählt werden, könnte der Widerstand der USA und weiterer Staaten gegen Mindestbesteuerung zunehmen. Insbesondere könnten sich die USA gegen die ergänzende Besteuerung von US-Steuersubstrat und Steuersubstrat von US-Unternehmen im Ausland (z.B. durch die Schweiz) mittels Sanktionsandrohungen zur Wehr setzen und die Anpassung wichtiger Mindestbesteuerungsregeln verlangen. Die Schweiz und ihre Unternehmen sollten sich deshalb in den kommenden Jahren auf eine stark fragmentierte internationale Steuerlandschaft vorbereiten. Vor diesem Hintergrund sollte der Bundesrat die nächsten Schritte in Sachen Umsetzung der Mindestbesteuerung genau prüfen (z.B. Einführung IIR) und sich die Freiheit nehmen, zum Schutz der Schweizer Volkswirtschaft auf gefällte Entscheide zu einem späteren Zeitpunkt zurückzukommen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Steuerstreitigkeiten mit Grossmächten wie den USA von der Schweiz nicht gewonnen werden können.
Fachbereich Wirtschaft
Die Schweiz verfügt über ein dichtes Netz an bilateralen Abkommen mit der EU. Mit der Aktualisierung von fünf bisherigen mit zwei neuen Binnenmarktabkommen sowie basierend auf Kooperationen in Forschung, Bildung und Gesundheit soll die Beziehung Schweiz-EU weiterentwickelt und stabilisiert werden. Diese Weiterentwicklung des Abkommensnetzes hat die EU allerdings an eine Klärung des institutionellen Rahmens geknüpft. Neu soll hierfür der Paketansatz vorgesehen werden. Statt die institutionellen Fragen gesamthaft in einem horizontal ausgelegten Abkommen zu regeln, sollen diese Fragen neu in jedem Abkommen einzeln sektorspezifisch gelöst werden. SwissHoldings begrüsst die Bemühungen des Bundesrates basierend auf einem neuen Vertragspaket mit der EU («Bilaterale III»), die bisherigen Beziehungen weiter auf eine solide und dauerhafte Grundlage zu stellen. Gleichzeitig gilt es aus Sicht des Verbandes, auf ein noch besseres Verständnis der längerfristigen Auswirkungen der dynamischen Rechtsübernahme auf den Standort Schweiz vor Vertragsschluss mit der EU hinzuarbeiten.
Die stark exportorientierte Schweizer Wirtschaft ist nebst geregelten Handelsbeziehungen mit der EU auch auf ein breites Netz von Freihandelsabkommen (FHA) angewiesen. Der Schweiz ist es gelungen, in den letzten Jahren dieses Netz laufend auszubauen. Besonders erfreulich diesbezüglich ist, dass dem Bundesrat jüngst nach 16 Jahren anfangs Jahr ein Durchbruch in den Verhandlungen für ein FHA mit Indien gelungen ist. Die Unterzeichnung des Abkommens am 10. März 2024 in Delhi zwischen den Staaten der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA: Schweiz, Island, Liechtenstein und Norwegen) und Indien nach 16 Jahren Verhandlungen ist ein bedeutender Meilenstein der schweizerischen Handelspolitik und von strategisch grosser Bedeutung für die Schweiz Wirtschaft. Darüber hinaus verhandelt die Schweiz weitere Abkommen mit Vietnam, Mercosur, Malaysia, Vietnam, Thailand sowie Kosovo. Zudem ist der Bund daran, bestehende Abkommen zu modernisieren.
Mit der Einführung einer Investitionsprüfung sollen Übernahmen von inländischen Unternehmen durch ausländische Investoren verhindert werden können, wenn diese Übernahmen die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der Schweiz gefährden oder bedrohen. Dazu hat der Bundesrat am 15. Dezember 2023 die Botschaft für ein Investitionsprüfgesetz zuhanden der Eidgenössischen Räte verabschiedet. Der Fokus der Investitionsprüfung wird auf staatlich kontrollierte Investoren sowie auf inländische Unternehmen gelegt, die in einem besonders kritischen Bereich tätig sind.
SwissHoldings verfolgt die Entwicklungen rund um die Investitionsabkommen eng und weist dabei auf die grosse Bedeutung dieser Abkommen für den Wirtschaftsstandort Schweiz hin. Mit über 111 bilateralen Investitionsschutzabkommen verfügt die Schweiz weltweit über das drittgrösste Netz solcher Abkommen. Aufgrund einer Praxisänderung des Bundesrats unterstehen neu neben den Freihandelsabkommen auch die ISA dem fakultativen Staatsvertragsreferendum. Das erste ISA, zu welchem eine Vernehmlassung durchgeführt worden ist, ist das neue ISA mit Indonesien.
Die Unternehmens-Verantwortungs-Initiative wurde am 29. November 2020 an der Urne abgelehnt. Dies ebnete den Weg für das Inkrafttreten des indirekten Gegenvorschlags. Schweizer Unternehmen werden im laufenden Jahr 2024 erstmals für das Geschäftsjahr 2023 nach den neuen Regeln Bericht erstatten. Des Weiteren hat der Bundesrat angekündigt, eine Anpassung der Gesetze gemäss der neuen Regulierungsansätze der EU im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung und Sorgfaltsprüfung zu prüfen.
Aktuell wird auf politischer Ebene in der Schweiz geprüft, ob die Schweiz ihr bestehendes Dispositiv an Instrumenten des kollektiven Rechtschutzes ausbauen soll. Der Bundesrat hat im Dezember 2021 dazu die entsprechende Botschaft zuhanden des Parlamentes verabschiedet. Die Wirtschaft steht diesen Bemühungen kritisch gegenüber. Der Bundesrat betrachtet die Streitbeilegung aus zu eingeschränkter Perspektive und fokussiert in seinem Vorschlag ausschliesslich auf ein bestimmtes Instrument im Prozessrecht. Dabei berücksichtigt er die Entwicklungen der letzten Jahre im Ausland, die neuen technologischen Möglichkeiten und mögliche Alternativen zur Sammelklage vor den Gerichten nicht.
SwissHoldings verfolgt die Entwicklungen im Bereich der IFRS-Standardsetzung eng. Für ihre international ausgerichteten Mitglieder ist ein weltweit anerkannter Reporting-Standard als Basis für die eigene Berichterstattung von zentraler Bedeutung. Nach dem Konvergenz-Prozess mit dem US-Standard US GAAP haben sich die Entwicklungen bezüglich der Überarbeitung der Standards ein wenig abgeflacht. In diesem Kontext gilt auch darauf hinzuweisen, dass der neue Fokus der IFRS-Stiftung – das ESG-Reporting – einen immer grösseren Stellenwert im Rahmen der Arbeiten der Organisation einnimmt.
In den heutigen ausserordentlichen Zeiten rückt zunehmend auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) in den Fokus der Aufmerksamkeit. Auf Ebene Parlament sind verschiedene Vorstösse behandelt worden, welche zum Ziel haben, die Ausschüttungen der SNB an gewisse politische Zwecke zu binden. Zudem wurden jüngst auch Anliegen eingegeben, welche eine Reform der Governance-Struktur der SNB fordern. Bei all diesen Projekten ist stets zu bedenken, dass es von zentraler Bedeutung ist, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) unabhängig von politischen Interessen handeln kann. Sie hat einen klaren Auftrag: Die Preisstabilität – ein zentraler Faktor unseres Wohlstandes – zu gewährleisten.