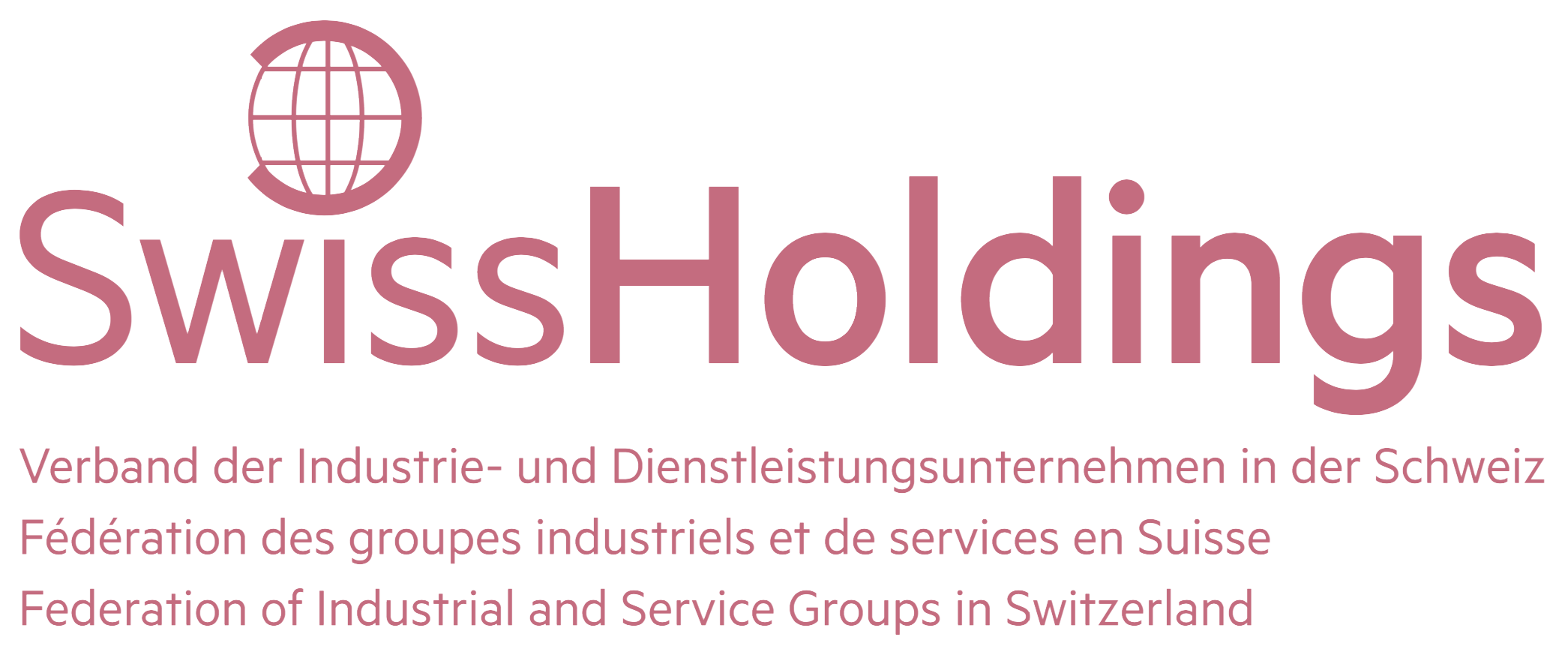Die USA unter Präsident Trump kündigen den Konsens zur OECD-Mindeststeuer auf und setzen auf eigene Regeln. Während Europa am 15 Prozent-Mindestsatz festhält, locken die USA mit attraktiveren Steuermodellen die Innovations- und Profitperlen der Zukunft. Ein gefährliches Ungleichgewicht entsteht, das besonders für die Schweiz mit ihren innovationsgetriebenen Unternehmen grosse Herausforderungen mit sich bringt. Das transatlantische Steuerduell birgt die Gefahr eines Wirtschaftskriegs – doch es gibt Wege aus der Sackgasse.
Donald Trump wirbelt derzeit die globale Wirtschaft mit seinen Zöllen und anderen Massnahmen stark durcheinander. Um sein Ziel zu erreichen, die USA wirtschaftlich erfolgreicher zu machen, die US-Bürger reicher zu stellen und Güter vermehrt in den USA herzustellen, ist er bereit, internationale Regeln in Frage zu stellen, um sie im Sinne der USA neu zu gestalten. Dabei setzt er auch im Bereich der Unternehmensbesteuerung an.
Trumps Steuerstrategie: Mit tiefen US-Unternehmenssteuern zu Erfolg und Wohlstand
Die Trump-Administration hat klar signalisiert, dass sie steuerliche Attraktivität für Unternehmen als wichtigen Baustein zur Erreichung ihrer Ziele betrachtet. So kündigte der Präsident Steuersenkungen auf 15 Prozent für Produktionsaktivitäten in den USA an. Noch bedeutender ist hingegen der am 20. Januar 2025 angekündigte Rückzug der USA vom OECD-Digitalbesteuerungsprojekt und die Androhung von Massnahmen gegen Staaten mit extraterritorialen und diskriminierenden Steuern. Neben ausländischen Digitalsteuern stören sich die USA an zwei zentralen Bausteinen der OECD-Mindeststeuer: UTPR und IIR. Beides sind extraterritoriale Steuern und stellen sicher, dass US-Unternehmen, die zu einem internationalen Konzern gehören und in den USA weniger als 15 Prozent Steuern zahlen, die Differenz in anderen Ländern nachzahlen müssen. Gelingt es der Trump-Administration, die Anwendung von IIR und UTPR auf tiefere US-Steuersätze zu unterbinden, können Unternehmen – insbesondere wirtschaftlich besonders erfolgreiche mit hohen Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaufwendungen – in den USA weiterhin von Gewinnsteuersätzen deutlich unter 15 Prozent profitieren.
Forderung der USA: Koexistenz von GILTI und OECD-Mindestbesteuerung
Dies soll erreicht werden, indem die US-Mindestbesteuerung, bestehend aus GILTI, CFC-Regelungen und anderen Elementen, von der OECD als gleichwertig zur OECD-Mindeststeuer anerkannt wird und beide Systeme nebeneinander koexistieren. Das würde heissen, dass auf sämtlichen ausländischen Töchtern von US-Muttergesellschaften anstelle der UTPR oder der IIR das GILTI-System zur Anwendung kommt. Dies würde innerhalb und ausserhalb der USA zu erheblichen steuerlichen und wirtschaftlichen Veränderungen führen. Denn die GILTI-Vorgaben sind aus Unternehmenssicht weniger streng. So beträgt der GILTI-Steuersatz aktuell maximal 13.125 Prozent und könnte sogar noch weiter gesenkt werden. Zudem erlaubt GILTI eine Mischkalkulation (Global Blending). Das heisst, die Steuersätze aus verschiedenen Ländern werden zu einem weltweiten Durchschnittssteuersatz zusammengefasst, der dann nicht unter dem Mindeststeuersatz liegen darf. Dadurch könnten ausländische Tochtergesellschaften von US-Muttergesellschaften, aber auch US-Zwischenholdings von Konzernen aus Mindeststeuerstaaten, in einzelnen Staaten weiterhin von Nullsätzen profitieren. Bei der OECD-Mindestbesteuerung wird hingegen für jedes Land einzeln geprüft, ob der Steuersatz mindestens 15 Prozent beträgt. Eine Koexistenz beider Systeme würde also zu einer Ungleichbehandlung zwischen US- und Nicht-US-Konzernen führen – mit teilweise erheblichen Nachteilen für Letztere.
Warum sollten OECD-Mindeststeuerstaaten dennoch auf die Forderungen der USA eingehen?
Die OECD-Mindestbesteuerung ist mit IIR und UTPR so aufgebaut, dass kein Staat seine multinationalen Unternehmen unilateral davor bewahren kann. Damit Staaten mit OECD-Mindeststeuer von der Anwendung der UTPR gegen US-Unternehmen absehen und die Koexistenz der US-Mindestbesteuerung anerkennen, plant die USA Sanktionsinstrumente. Konkret sollen zwei solcher Instrumente (Section 899 sowie SuperBEAT) in das sich in Erarbeitung befindende Budget Reconciliation Bill aufgenommen werden. Diese sehen für Unternehmen aus Staaten, welche insbesondere die UTPR gegen US-Gesellschaften anwenden wollen, äusserst schmerzhafte Massnahmen vor. Der massive Druck aus den USA fordert eine Reaktion jener Staaten, welche die OECD-Mindestbesteuerung bereits eingeführt haben.
Diplomatisches Ringen um den Steuerfrieden
Insbesondere für die EU-Staaten mit eingeführter UTPR und IIR stellt sich die Frage, wie sie auf die US-Forderung und die angedrohten massiven Sanktionen reagieren sollen. Die EU-Staaten wie auch die EU-Kommission dürften sich der erheblichen Wettbewerbsnachteile bewusst sein, die für ihre Konzerne aus der Koexistenz gegenüber amerikanischen Konkurrenten resultieren. Die EU ist jedoch aktuell bestrebt, ihre wirtschaftliche Attraktivität zu verbessern. Besonders die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den USA soll gemäss Draghi-Report im Zentrum stehen. Für die im Draghi-Report genannten besonders wichtigen innovativen Unternehmen Europas würde eine Koexistenz beider Systeme den Anreiz stark erhöhen, Aktivitäten von Europa in die USA zu verlegen. Dies gilt auch für Schweizer Unternehmen. In den USA könnten die Unternehmen, neben vielen nicht-fiskalischen Vorteilen (Kapitalmarkt, etc.) von attraktiven Steuerregelungen für Investitionen im F&E&I-Bereich profitieren. Gleichzeitig wollen die EU-Mitgliedstaaten an der OECD-Mindeststeuer unbedingt festhalten. Die US-Steuersanktionen würden viele wichtige europäische Unternehmen aber hart treffen, was nicht im Interesse der europäischen Regierungen ist. Gleichzeitig müsste für die Anerkennung der Koexistenz Einstimmigkeit unter den EU-Mitgliedstaaten erreicht werden, um die EU-Mindeststeuerdirektive anzupassen. Angesichts der von den USA eingeführten Handelszölle, dürfte die Bereitschaft den USA entgegenzukommen, in den europäischen Hauptstädten dennoch gering sein. Aktuell laufen hinter den Kulissen Gespräche zwischen den USA und der EU-Kommission, um einen Wirtschaftskrieg mit gegenseitigen Sanktionen zu verhindern. Ein solcher Konflikt würde Unternehmen beider Wirtschaftsräume sowie der Schweiz finanziell stark belasten.
Anpassungen auf OECD-Ebene: Ziel müssen gleich lange Spiesse sein
Die Situation ist aktuell sehr komplex und das Risiko wirtschaftlicher Nachteile für Europa und insbesondere für die Schweiz ist gross. Die Staaten mit OECD-Mindeststeuer sollten daher sicherstellen, dass sie im Steuerwettbewerb mit den USA über gleich lange Spiesse verfügen, wenn eine Koexistenz von GILTI und der OECD-Mindestbesteuerung kommt – wovon wir zum jetzigen Zeitpunkt ausgehen. Hierfür sind aus Sicht von SwissHoldings zwei Anpassungen der OECD-Mindeststeuerregeln unerlässlich.
Erstens müssen bestimmte Steuerabzüge, welche innovativen Unternehmen zugutekommen, unter den OECD-Regeln möglich sein. Unternehmen primär aus dem Technologie-, dem Pharma- und einzelnen weiteren Sektoren in den USA, der Schweiz und anderen Staaten weisen heute effektive Gewinnsteuersätze von unter 15 Prozent auf. Sollen die Investitionen und Innovationen, die schlussendlich zu den erheblichen Steuererträgen dieser Unternehmen führen, langfristig gesichert werden, müssen die OECD-Mindeststeuerregeln den Staaten zugestehen, dass sie Unternehmen, die im In- oder Ausland erheblich in Innovationen inklusive Produktinnovationen oder andere sogenannte «gute Bereiche» (z. B. Reduktion des CO2-Ausstosses) investieren, ausgewählte Steuerabzüge gewähren dürfen. Mit anderen Worten muss die heutige Unterscheidung zwischen den «guten» Qualified Refundable Tax Credits und den «bösen» Non-Refundable Tax Credits aufgehoben werden. Gleichzeitig sind vernünftige Regeln im Bereich «Related Benefits» zu schaffen, welche die Förderung zukunftsgerichteter innovativer Tätigkeiten nicht behindern. Wichtig sind ausserdem administrative Erleichterungen. Die Anwendung sämtlicher OECD-Mindeststeuervorgaben dürfte für viele der betroffenen Unternehmen und Steuerverwaltungen schlichtweg zu komplex sein.
Zweitens sollte die OECD-Mindeststeuer in Richtung des GILTI-Systems mit seinem Global Blending reformiert werden. Mit anderen Worten dürfen IIR und UTPR nur noch greifen, wenn wie bei GILTI der Global-Blending-Mischsatz unter 15 Prozent liegt. Können diese beiden Neuerungen zusammen mit wirksamen administrativen Erleichterungen umgesetzt werden, verfügen die europäischen Staaten (inkl. der Schweiz) im Steuerwettbewerb mit den USA zumindest über ähnlich lange Spiesse. Dass diese Änderungen der Mindeststeuer nicht im Sinne der Erfinder sind, mag zutreffen. Wenn sich mit den USA allerdings die wirtschaftlich bedeutendste und innovativste Volkswirtschaft der Welt vom Anwendungsbereich der OECD-Mindeststeuer herausnimmt, müssen die verbleibenden Staaten reagieren und können nicht einfach so tun, als wäre nichts geschehen.
Die Schweiz im globalen Steuerumbau
Ein unilateraler Ausstieg der Schweiz aus der OECD-Mindestbesteuerung kommt derzeit nicht in Frage. Die Regeln der OECD-Mindestbesteuerung bleiben nämlich in Kraft. Das heisst, solange wichtige Märkte wie die EU die Mindestbesteuerung umsetzen, werden Schweizer Unternehmen die Mindeststeuer dank IIR und UTPR ohnehin bezahlen. Sie bezahlen sie nur nicht mehr in der Schweiz, sondern im Ausland. Die Schweiz verfügt nicht über das wirtschaftliche und politische Gewicht der USA, um bei der OECD die notwendigen Zugeständnisse zu erwirken, die ihre Konzerne vor der Mindestbesteuerung schützen. Für die Schweiz gilt es deshalb, auf internationaler Ebene mit Nachdruck auf die oben beschriebenen Anpassungen der OECD-Mindestbesteuerung hinzuwirken. Parallel dazu muss die Schweiz innenpolitisch flexibel und pragmatisch bleiben und sich bestmöglich auf die neuen Standortwettbewerbsregeln einstellen.
Kontakt
Martin Hess | Leiter Steuern und Steuerpolitik, Mitglied der Geschäftsleitung
martin.hess@swissholdings.ch | +41 31 356 68 61
Redaktionsschluss dieses Editorials war der Freitag, 9. Mai 2025.